Basic HTML-Version

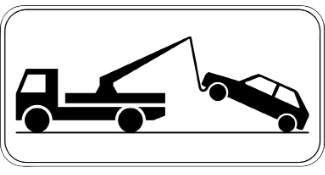
dem Jahr 1996 die Auffassung, dass auch
die Verbringung zur Heimatwerkstatt er-
forderlich sein kann, wenn der Geschä-
digte ein schutzwürdiges Interesse für die
Verbringung des Fahrzeugs in seine Hei-
matwerkstatt hat. Dieses Interesse kann
beispielsweise dadurch begründet sein,
dass der Geschädigte seit Jahr und Tag sein
Fahrzeug in dieser Werkstatt warten und
reparieren lässt oder, dass diese Werkstatt
über besondere Qualifikation zur Repara-
tur des beschädigten Fahrzeugs verfügt,
beispielsweise für den Fall der Reparatur
eines Oldtimers, wobei diese Aufzählung
selbstverständlich nicht abschließend ist.
Zu berücksichtigen und ins Verhältnis zu
setzen sind zusätzlich natürlich die Kosten,
die der Geschädigte erspart, indem er sein
später repariertes Fahrzeug nicht von der
Fernwerkstatt abholen oder nach Hause
verbringen lassen muss.
Nicht erstattungsfähig
Abschleppkosten zur Heimatwerkstatt
sind jedoch selbstverständlich dann nicht
erstattungsfähig, wenn offenkundig ein
Totalschaden vorliegt. Ist dem Geschä-
digten die Entscheidung der Frage, ob ein
Totalschaden vorliegt, nicht ohne weiteres
möglich, wäre er gut beraten, das Fahr-
zeug zunächst nur bis zum nächstgele-
genen Sachverständigenbüro bzw. zur
nächsten Fachwerkstatt abschleppen zu
lassen. Anders liegt der Fall allerdings,
wenn er nach eigener Anschauung nicht
mit einem Totalschaden rechnen musste.
Hier könnte sich ihm der Abschleppvor-
gang zur Heimatwerkstatt als erforderlich
und aufgrund der später ersparten Abho-
lung als wirtschaftlich sinnvoll darstellen.
Unter Berücksichtigung der zuvor er-
wähnten Aspekte sind daher die Kosten
eines Abschleppens über mehrere hundert
Kilometer zur Heimatwerkstatt, die über
300 bis 400 Euro hinausgehen, dann nicht
erstattungsfähig, wenn entweder ein To-
talschaden erkennbar war oder – sofern
dies nicht der Fall war – spätere Abhol-
kosten erheblich günstiger gewesen wä-
ren. Anderenfalls dürfte die Versicherung
die geltend gemachten Abschleppkosten
von 345 Euro zu zahlen haben.
Wertminderung bei
Leasingfahrzeugen
Frage:
Wer darf bei verunfallten Leasing-
fahrzeugen die Wertminderung beanspru-
chen und wie wird dies bei Leasingrück-
läufern berücksichtigt?
Frank Häcker:
Die Wertminderung ge-
hört zum Substanzschaden, weshalb der
Anspruch auf Ersatz dieses Minder-
betrages dem Eigentümer zusteht. Egal,
welche Art des Leasings gewählt worden
ist, steht das Leasingobjekt stets im Eigen-
tum des Leasinggebers. Also muss die
Wertminderung zunächst immer an den
Leasinggeber gezahlt werden. Wurde
schon an den Leasingnehmer geleistet, hat
er sie daher erst mal weiterzuleiten.
Sofern aber der Leasingnehmer das
Restwertrisiko trägt, muss die an den Lea-
singgeber geleistete Wertminderung
wertmäßig berücksichtigt werden. Der
Leasinggeber darf durch das Schadenser-
eignis nicht doppelt begünstigt werden.
Hier ist nun amVertragsende je nach Lea-
singart zu unterscheiden:
Beim Vertrag mit Abschlusszahlung
bzw. mit Restwertabrechnung ist die
Wertminderung auf den vom Leasingneh-
mer zu zahlenden Ausgleichsbetrag anzu-
rechnen – sofern einMehrerlös verbleiben
sollte, ist dieser anteilsmäßig aufzuteilen.
Noch Fragen?
Sind Rechtsaspekte unklar? Haben Sie Fragen an
die Fachanwälte? Dann schreiben Sie bitte an:
AUTOHAUS SchadenBusiness
Otto-Hahn-Straße 28
85521 Ottobrunn-Riemerling
d.mielchen@mielco.de
Beim Vertrag mit Andienungsrecht muss
der Leasinggeber die erhaltene Wertmin-
derung komplett an den Leasingnehmer
auskehren, wenn Letzterer von seinem
Andienungsrecht Gebrauch macht.
Allein bei einem Leasingvertrag mit
Kilometerabrechnung und bei Leasing-
rückläufern trägt der Leasinggeber das
Verwertungsrisiko auch über das Ver-
tragsende hinaus.
Die Ausgestaltung des konkreten Lea-
singverhältnisses ist von Vertrag zu Ver-
trag unterschiedlich. Teilweise finden sich
zur Frage des Wertminderungsanspruches
abweichende oder ergänzende Regelun-
gen zum oben Gesagten imKleingedruck-
ten der Vertragstexte. Allerdings können
diese AGB auch unzulässig sein, womit
die allgemeinen Regelungen anwendbar
wären. Daher sollte jeder Fall sorgfältig
von einem Anwalt geprüft werden, damit
sowohl für den Leasingnehmer, als auch
für den Leasinggeber keine bösen Über-
raschungen entstehen.
Frage:
Was, wenn vergessen wurde, eine
Wertminderung zu beanspruchen? Kann
das nachgeholt werden?
Frank Häcker:
Jeder Anspruch kann
geltend gemacht werden, solange er nicht
verjährt ist. Dies gilt auch für den An-
spruch auf Wertminderung. Hier beträgt
die Verjährungsfrist drei Jahre. Sie beginnt
in dem Jahr, in welchem der Leasinggeber
Kenntnis von den anspruchsbegründen
den Umständen, hier also vom Unfall
ereignis hatte oder haben müsste, und
endet am Schluss des darauffolgenden
dritten Jahres. Eventuell verlängert sich
dieser Zeitraum aber, sofern die Verjäh-
rung gehemmt wurde. Dies sollte im Ein-
zelfall genau überprüft werden.
■
Abschleppkosten zu einer weiter entfernt
gelegenen Vertrauenswerkstatt können
erstattungsfähig sein, wenn hierdurch nicht
erheblich höhere Kosten ausgelöst werden
und diese in einem angemessenen Verhältnis
zu den Reparaturkosten stehen.
AUTOHAUS schadenrecht
80
Autohaus
10/2012
